
Was bedeutet Schöpfung heute?
Leitartikel von Christian Link
Auf die Frage, wo in seiner Theorie der Planetenentstehung Gott vorkommt, soll der Mathematiker Pierre S. Laplace Napoleon mit dem Diktum geantwortet haben: „Sire, ich habe diese Hypothese nicht nötig!“ Laplace antwortet als Wissenschaftler. Seine Wissenschaft kommt seit Galilei und Descartes ohne die Annahme eines Gottes aus. Er fragt nach der Natur, nicht nach der Schöpfung. Denn die Frage nach der Schöpfung kann den Schöpfer, der die Welt im ganzen „gemacht“ hat, nicht ausklammern.
Nach dem Schöpfer aber kann man nicht fragen wie nach der Gravitationskonstante der Erde oder nach der Existenz des Higgs-Teilchens. Es braucht eine andere Perspektive, um die Welt als sein Werk zu Gesicht zu bekommen. Die Natur ist nach der Definition Kants „das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist“. In dieser Beschreibung erscheint die Welt unter der Führung eines bestimmten Zeitmodus, der Gegenwart. Wir erfahren sie als Inbegriff aller objektivierbaren Phänomene. Als Schöpfung aber ist sie mehr als das, was „der Fall ist“, was wir messen oder berechnen können. Wir erfahren sie als eine Wirklichkeit, in die wir selbst mit eingebunden sind, die uns durch ihre Schönheit oder Rätselhaftigkeit provoziert und die sich auf eine Zukunft hin öffnet, in der noch unabsehbar Neues geschehen kann. Geht es dort, in der Beschreibung der Natur, um die Frage: Was kann ich wissen?, so hier um die Frage: Was soll ich tun? und: Was darf ich hoffen?

Es ist in der Tat eine andere Perspektive, unter der wir hier in die Welt eingewiesen werden. Im Vordergrund steht die uns heute weithin abhanden gekommene Orientierung an über elementare Lebensfragen, so am Thema der Ökologie: Wie gehen wir mit der Natur und ihren begrenzten Ressourcen um? Gibt es Rechte der Natur, Sorgerechte für die nach uns kommenden Generationen? Oder am Thema der Bioethik: Wie gehen wir mit pflanzlichem und tierischem Leben um, vorab aber mit uns selbst, mit unseren Krankheiten und mit dem Wissen, dass wir sterben müssen?
Dennoch lässt sich an der Einheit der Wirklichkeit, die der Physiker mit dem Theologen, der Agnostiker mit dem Mönch teilt, vernünftigerweise nicht zweifeln. Die Relativitätstheorie redet von demselben Universum wie der 8. Psalm unserer Bibel. Das Standardmodell der Kosmologie fragt nach dem Anfang derselben Welt wie das 1. Kapitel der Genesis. Nur tun sie es auf eine denkbar verschiedene Weise, in unterschiedlichen Sprachen und mit einer unterschiedlichen Absicht. Es sind, mit Wittgenstein geredet, verschiedene „Sprachspiele“, in denen sie ihre Aussagen formulieren, Sprachspiele, die eine verschiedene innere Logik ausbilden und sich deshalb nicht widersprechen können. Dennoch kann die Theologie, will sie sich ihrer Gegenwart verständlich machen, auf den teils rezipierenden, teils kritischen Umgang mit der Naturwissenschaft nicht verzichten, sich über die dort gewonnenen Erkenntnisse nicht einfach hinwegsetzen. Denn wir leben niemals in nur einem Sprachspiel allein, sondern immer in mehreren zugleich. Das ist es, was den Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft so schwer macht. Die Erfahrungen, die hier und dort eingebracht werden, liegen auf verschiedenen Ebenen. Die Theologie argumentiert in der Perspektive existenzbetroffener Wahrnehmung. Sie geht von lebensweltlichen Erfahrungen aus, die in der Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes eingebracht werden. Sie ist der Versuch, über diese Erfahrungen mit den kritischen Mittel des Denkens Rechenschaft abzulegen.
Welche Horizonte öffnet uns das Reden von der Schöpfung?
1. Schöpfung als Utopie
Man erfasst das besondere Profil der Schöpfung am sichersten, wenn man darauf aufmerksam wird, dass sie uns in der biblischen Überlieferung als ein utopischer Entwurf vorgestellt wird. Gott pflanzte einen „Garten in Eden gegen Osten“ und „setzte den Menschen, den er gebildet hatte, darein“ (Gen 2,8). Wir werden im Raum verortet. Diesen Raum aber haben wir unwiderruflich verloren. Die Tore des Gartens haben die Keruben nach dem „Sündenfall“ hinter uns verriegelt. Statt an den „Ursprung“ anzuknüpfen, sehen wir nur den Verlust, den Bruch, der uns von ihm trennt. Der „Garten in Eden“ ist zum „Garten Eden“ geworden (Gen 2,23), zum verlorenen Paradies, das jetzt nicht mehr hinter uns liegt, sondern vor uns – als Ziel der „letzten“ Reise, die wir anzutreten haben. Wohl bleibt er das von Gott uns bestimmte Modell menschlichen Lebensraumes, doch auf der Erde, die wir bewohnen, ist dieser Raum nicht mehr zu finden, er hat hier keinen Ort. Er ist zum Nicht-Raum geworden, zur U-topie in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Gemessen an allem, was uns hier und heute umgibt, ist er nur als Gegenwelt aussagbar, als Gegenentwurf eines Lebens, von dem wir uns seit frühester Zeit getrennt haben. Denn wie war es „ im Anfang“ gemeint? „Herrschen“ soll der Mensch „über alles, was auf Erden sich regt“ (Gen 1,26), doch was das bedeutet, wird mit einem Wort umschrieben, das die Aufgabe des Hirten beschreibt, der dafür sorgt, dass seine Herde genug Wasser und Nahrung findet. Das Beherrschte, ob Pflanze oder Tier, soll nicht zum Objekt willkürlicher Verfügung werden. Vegetarisch leben hier Mensch und Tier; kein Leben soll sich auf Kosten anderen, fremden Lebens behaupten müssen. Zwar wird die Schlachtung der Tiere nach der Sintflut freigegeben, der Blutgenuss aber wird untersagt. Blutvergießen soll nicht das Modell für den Umgang des Menschen mit seinesgleichen abgeben, so dass die Geschichte der Menschheit so gewaltsam verlaufen müsste, wie sie faktisch bisher verlief. Die uns verordnete Ruhe des siebenten Tages schließlich (Ex 20,8) hat mit dem Ausruhen „nach getaner Arbeit“ nichts zu tun. Sie meint – das ist ihr utopischer Gehalt – die definitive Unterbrechung von Arbeitsverhältnissen selbst (analog der Befreiung Israels aus dem „Sklavenhaus“ Ägyptens, Dtn 5,15): Sie soll das Bewusstsein an die noch ausstehende Freiheit der Menschengattung wach halten, mit Adorno gesprochen: dass Bewusstsein, dass das, „was ist, nicht alles ist“. So gewinnt die Schöpfung ihre Leuchtkraft und Farbe von dem zukünftigen Ziel, auf das zuzugehen wir bestimmt sind, – einem Ziel, das die wissenschaftlich erforschte Naturgeschichte nicht kennt.

2. Schöpfung: eine Welt in Grenzen
Durch den „Sündenfall“, sagte ich, haben wir das „Paradies“, den Raum der Schöpfung, verloren. Was ist damit gemeint? Bonhoeffer hat das vertraute Bild des verbotenen Baumes in der Mitte des Gartens (Gen 2,9) als Hinweis auf eine Grenze interpretiert, die unserer theoretischen Neugier und unserem Handeln gezogen ist, eine Grenze, jenseits derer wir unsere Geschöpflichkeit verleugnen und damit uns selbst verfehlen:
Der Baum, „der die Grenze des Menschen bezeichnet, steht in der Mitte. Die Grenze des Menschen ist in der Mitte seines Daseins, nicht am Rand: die Grenze, die am Rand des Menschen gesucht wird, ist Grenze seiner Beschaffenheit, Grenze seiner Technik, Grenze seiner Möglichkeit. Die Grenze in der Mitte ist Grenze seiner Wirklichkeit, seines Daseins schlechthin.“ (Schöpfung und Fall, DBW 3,80)
Hier wird eine entscheidende Erkenntnis ausgesprochen: Erschaffen heißt in Gen 1 Grenzen setzen – zwischen Chaos und Kosmos, Himmel und Erde, Festland und Meer, und dadurch definierte Verhältnisse und Beziehungen stiften, die der Grund dafür sind, dass sich das Leben durch Auswahl und Entscheidung von Möglichkeiten entwickelt. Geschöpfsein heißt in Grenzen existieren. Die Endlichkeit ist unsere Auszeichnung, nicht ein zu behebender Mangel.
Um welche Grenzen geht es? Seit in den 70er Jahren des letzten Jh.s der Club of Rome mit seinem Bericht über die „Grenzen des Wachstums“ die ökologische Bewegung angestoßen hat, kennen wir die Probleme, um die es sich hier handelt: in einer Welt mit endlichen Ressourcen kann es kein unendliches Wachstum geben. Eine offenkundige Grenze setzt uns die Zeit. Denn die Schöpfung ist ein Werdegeschehen in der Zeit. Wir aber leben in einer „Beschleunigungsgesellschaft“, in der Wachstumsprozesse gar nicht schnell genug ablaufen können. Unter naturnahen Bedingungen vollzieht sich die Evolution in außerordentlich langen Zeiträumen. Mit dem atemberaubenden Tempo der technischen und heute gentechnisch gesteuerten Entwicklung hält die Natur nicht Schritt, und so droht die lebensnotwendige Verbindung zwischen der Naturgeschichte und der Dynamik der menschlichen Geschichte zu zerreißen. Unter dem Druck unserer Wachstumsinteressen öffnet sich die Schere zwischen Natur- und Menschheitsgeschichte immer weiter – mit unabsehbaren Folgen für das Gleichgewicht der Erde. Hier ist die Erinnerung an die Schöpfung ein unüberhörbarer Not- und Alarmruf.
Auch der Raum, verstanden als Raum einer bestimmten Kultur und Gesellschaft, in die wir als Glieder eines bestimmten Volkes hineingeboren werden, meldet sich mitunter als eine schmerzlich erfahrene Begrenzung. Denn alle, auch uns fremde Kulturen sind zugleich Wohnungen des Menschen, die unserem Lebensraum Grenzen setzen. Dies anzuerkennen, macht uns die Absage an jedes nationalistische, vollends rassistische Überlegenheitsgefühl zur Pflicht.
Den so bestimmten Grenzen korrespondieren bestimmte Maße. Dabei geht es nicht um Elemente einer Operation des Messens, sondern um innere Proportionen der Schöpfungswelt, modern gesprochen: um die Erhaltung von Gleichgewichten zwischen dynamischen Verhältnissen, in denen sich der Rhythmus der Lebensvorgänge vollzieht. Ein solches Maß ist die in biblischer Weite begriffene Gerechtigkeit, also die Fähigkeit, der besonderen Situation gerecht zu werden, in die wir im Gegenüber zu unserer Erde und zu den nach uns kommenden Generationen hineingestellt sind (was uns heute immer weniger zu gelingen scheint). Ein analoges Maß ist der Friede, der die kosmisch-naturhafte Einrichtung der Welt mit umfasst und deshalb nicht menschlicher Willkür oder Einsicht entspringt, sondern allein von Gott selbst garantiert werden kann. Ein solches Maß ist schließlich auch die sinnenfällige Schönheit der Natur, die, wie wir heute wissen, ein hochempfindliches Kriterium für deren ökologische „Integrität“ ist. Auch in ihr meldet sich ein Ordnungszusammenhang der Welt, der unserem Bewusstsein vorausliegt.
3. Ethik der Selbstbegrenzung
Es ist nach allem bisher Gesagten deutlich, dass wir mit jedem Schritt unserer kulturellen Emanzipation – beim Städtebau, bei der Erprobung neuer landwirtschaftlicher Methoden und vollends bei der Entwicklung medizinischer Technik – wie Adam jedes Mal neu vor einer kreatürlichen Grenze stehen, die wir respektieren oder über die wir uns hinwegsetzen werden.
Das zeigt sich zunächst an den gravierenden Folgen unseres Umgangs mit der subhumanen Welt: Früher wurde die evolutive Selektion durch Krankheiten, Hunger oder Natur-katastrophen erzwungen; sie war Teil der Gegenwelt „Natur“ Heute ist sie, wie das stille Aussterben ganzer Tier- und Pflanzenarten dokumentiert, zur Natur des Menschen selbst geworden, sie ist Teil seiner Kultur. Die Einsicht wächst – das ist die wichtigste Sichtöffnung, die wir der Bestimmung der Welt als Schöpfung verdanken –, dass der Einklang unserer gesellschaftlichen Entwicklung mit dem ökologischen Rhythmus der Natur der Preis ist, den das Leben auf der Erde uns abverlangt. Die Erinnerung an unsere geschöpfliche Herkunft müsste der Tendenz, alles zu „machen“, was wir machen können, in den Arm fallen. Eine Ethik der Selbstbegrenzung ist die Konsequenz, die aus dieser Einsicht folgt. Die nicht rekonstruierbare Einmaligkeit unserer Erde macht sie uns nachgerade zur Pflicht.
Die damit gezogene Grenze aber betrifft zuletzt auch unser Verhältnis zu uns selbst. Dass Gott uns in Adam und Eva „ihm zum Bilde“ als freie Wesen erschaffen hat, muss man nicht glauben, um zu verstehen, was mit dieser Ebenbildlichkeit gemeint ist. Denn Gott steht für uneinholbare und darum unverfügbare Wirklichkeit ein, die uns zu unserm Dasein ermächtigt hat. Dass wir ihm „gleichen“, bedeutet, dass wir uns als Subjekte zur Welt verhalten können, und das schließt ein, dass das „Bewusstsein rechenschaftpflichtiger Autorschaft [unseres Handelns] … den Kern [unseres] Selbstbewusstseins“ ausmacht (J.Habermas, Glauben und Wissen, 19f.). Dieser Erkenntnis steht heute die avancierte Hirnforschung entgegen, die eben dieses personale Selbstverständnis durch eine „objektivierende Selbstbeschreibung“, in praxi durch eine neuronal gesteuerte Determinierung, nicht nur zu ergänzen, sondern abzulösen versucht und damit im Begriff steht, das Zentrum der menschlichen Subjektivität, das Vermögen freier Selbstbestimmung (das, was man früher Seele, Geist oder Denken nannte) zu eliminieren. Damit werden wir – Habermas hat darauf hingewiesen (ebd. 17) – aus der sozialen Sphäre, in der wir unsere Handlungen mit einsichtigen Gründen rechtfertigen müssen (statt sie als Naturvorgänge zu erklären), herausgedrängt; wir werden „vollständig entsozialisiert“. Hier wird etwas elementar Menschliches verfehlt.
An diese kritische Grenze hat uns bereits die moderne Genetik geführt. Auch sie arbeitet der Naturalisierung des Menschen in die Hände. Wohl haben wir mit der Entzifferung unseres eigenen Genoms Gottes Wissen usurpiert, kaum aber seine Einsicht geerbt. Unser Leib wird nun zum Körper, er wird genetisch definierbar. Doch ein solches Konzept der eigenen Natur enthält keinerlei Anhaltspunkt mehr, dieser Natur Achtung, geschweige denn Würde zuzuschreiben.
Was bedeutet Schöpfung heute? lautet die mir gestellte Frage. Es bedeutet, der Versuchung zu widerstehen, an den Ort der „Mitte“, den Bonhoeffer mit der biblischen Überlieferung allein Gott reservieren wollte, nun den Menschen, seine wissenschaftlich programmierten Bilder und Rollenerwartungen, zu setzen, die das in der Schöpfung verankerte Eigenrecht der Natur und damit zuletzt ihn selbst als das zur Freiheit bestimmte und darum zukunftsoffene Wesen bedrohen.
Christian Link Veröffentlicht im Juni 2013
Sie lesen lieber aus einem Buch? Sie finden diesen Artikel auch in unserem Buch zu dieser Webseite, "Wissenschaft und die Frage nach Gott" (Bonn 3. Aufl. 2018). 18 Beiträge von renommierten Autorinnen und Autoren, darunter die Erzbischöfin von Schweden, führen in den Dialog mit der Wissenschaft angesichts der Gottesfrage ein.
Christian Link hat Physik, Mathematik, Theologie und Philosophie studiert. Nach einer Professur für Dogmatik und Philosophiegeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bern/ Schweiz wurde er Professor für Systematische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum. Er war Vorsitzender des damaligen Gesprächskreises für Theologie und Naturwissenschaften an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal.
Zur weiteren Lektüre empfehlen wir Christian Links neues Buch "Schöpfung", erschienen im Neukirchener Verlagshaus 2012.
Bildnachweis
Erde © Mopic - Fotolia.com
Zukunft-Collage © XtravaganT - Fotolia.com
Creek and cascade © Biletskiy Evgeniy - Fotolia.com
Apfelbaum © Tom Bayer - Fotolia.com
Glasfenster © Argonautis - Fotolia.com
Diesen Beitrag fand ich...
Was bedeutet Schöpfung heute?
Für Christian Link ist es der Widerstand gegen eine Versuchung - und für Sie?
Schöpfung bedeutet für Christian Link heute, der Versuchung zu widerstehen, an den Ort der „Mitte“, den Bonhoeffer mit der biblischen Überlieferung allein Gott reservieren wollte, nun den Menschen, seine wissenschaftlich programmierten Bilder und Rollenerwartungen, zu setzen, die das in der Schöpfung verankerte Eigenrecht der Natur und damit zuletzt ihn selbst als das zur Freiheit bestimmte und darum zukunftsoffene Wesen bedrohen. Was bedeutet Schöpfung für Sie?
An erster Stelle haben wir Dr. Alexander Maßmann (Heidelberg) um eine Stellungnahme zum Artikel von Prof. Link gebeten.







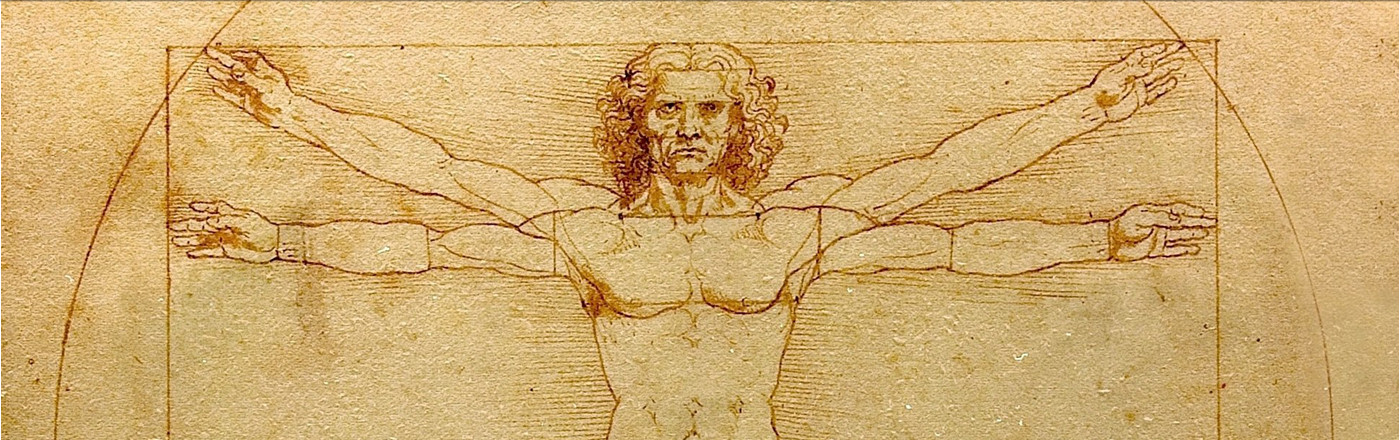








Kommentare (1)-

Antworten
Christian Link hat jüngst eine neue Bearbeitung seiner einschlägigen großen Schöpfungsmonographie vorgelegt. In dem hier wiedergegebenen Artikel liegt sein Augenmerk nicht darauf, ob die Naturwissenschaften für Einsichten sensibilisieren könnten, die der Theologie sonst zu ihrem eigenen Schaden entgehen würden. Auch lenkt er die Aufmerksamkeit nicht darauf, wie sich das christliche Bekenntnis, Menschen und Tiere seien Geschöpfe Gottes, etwa angesichts der langwierigen Evolution der Spezies durch Mutation und Selektion, verstehen lässt. Dass sich Theologie „verständlich“ macht, ist vielmehr Verifikation im performativen Sinne. Schöpfung dagegen erscheint hier in erster Linie als „verlorenes Paradies“ („Verlust“, „Bruch“) einerseits und andererseits als Verheißung der einstigen restitutio ad integrum, der endzeitlichen Wiederherstellung des einstmaligen Urstandes. Die Rede von der Schöpfung markiert eine „Gegenwelt“ und „U-topie“, die kritisch angesichts der Herausforderungen in Ökologie und reduktionistisch-naturwissenschaftlicher Anthropologie zur Geltung zu bringen ist. Die Auffassung, dass wir als mündige Subjekte „rechenschaftspflichtig“ sind für unseren Umgang mit dem Leben, genießt zwar noch kulturelle Akzeptanz; doch scheint es sich hier nach Link noch um eine Spätfolge des jüdisch-christlichen Erbes zu handeln (Gottesebenbildlichkeit), nicht um die Strahlkraft der Natur selbst.
Alexander Maßmann
am 30.06.2013Diese Position verteilt die Gewichte anders als andere Stellungnahmen Links. So betont der Autor des ersten Bandes der Schöpfungslehre von 1991 etwa im Blick auf Karl Barth, dass er die Schöpfung „nicht primär als einen naturhaften Kosmos, sondern als Raum einer offenen, in die Zukunft weisenden Geschichte“ darstellt. „Nicht schon die Natur, sondern die eine Geschichte ermöglichende und freisetzende Natur ist ihr [sc. der Schöpfung] Geheimnis und darum die Verschränkung von beidem die Pointe.“ (326f)
Gewiss ist dabei die tiefe Ambivalenz der Natur stets zu bedenken. Doch weicht sie nicht im gegenwärtigen Aufsatz einem harten Widereinander zwischen einer idyllischen Schöpfung und einer einseitig problematischen Natur? Dass der erste Schöpfungsbericht den Menschen zum „Hirten der Tiere“ bestellt, schließt nicht aus, dass sein schützendes Wirken stets zugleich mit Gewalt verbunden ist (rdh „herrschen“, Gen 1,28); hinzu kommt der problematische Auftrag, sich die Erde „untertan zu machen“ (kbš). Ist die christliche Existenz nicht in einem „unglücklichen Bewusstsein“ des Unheils zwischen abstrakter Erinnerung und vager Hoffnung gefangen, wenn man dieser Ambivalenz ausweicht?
Andererseits bringt die ambivalente Verschränkung von Natur und Schöpfung neben zahlreichen Gefährdungen auch ein Potential mit sich, dessen sich Gott im Werk der Versöhnung und der Erlösung bedienen möchte. Die tiefe Ambivalenz lässt gewiss jeden Versuch der natürlichen Gotteserkenntnis problematisch erscheinen. In seiner Habilitationsschrift traf Link die Aussage, „Die Welt ist kein Gleichnis des Himmelreichs, sie kann es nur werden“. Doch gewinnt diese Aussage nicht angesichts der beschriebenen Ambivalenz insofern an Überzeugungskraft, als Gott bestehende Eigenschaften der Natur in einen neuen Wirkzusammenhang einfügen mag, in dem sie nun, und zwar geschichtlich, als „Schöpfung“ erfahrbar werden?
Dr. Alexander Maßmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Systematische Theologie (Dogmatik) an der Universität Heidelberg und forscht, ab Herbst gefördert von der DFG, zum Dialog zwischen Schöpfungstheologie und Evolutionsbiologie.